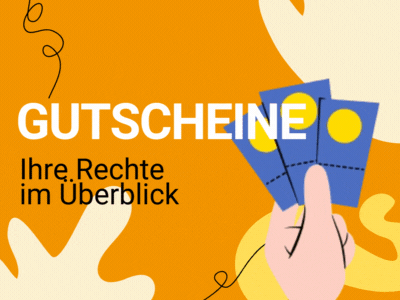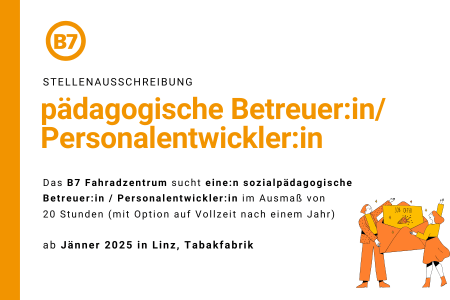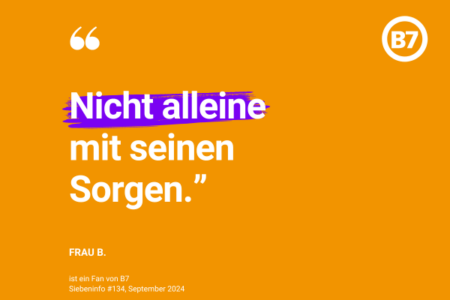Care-Arbeit fair teilen – Für ein gerechteres Miteinander
28. Januar 2025In Österreich übernehmen Frauen im Schnitt 43 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer – das entspricht pro Tag etwa 1 Stunde und 16 Minuten mehr. Doch was bedeutet das konkret für unser Leben, und wie können wir gemeinsam die Verteilung von Care-Arbeit gerechter gestalten?
Unbezahlte Care-Arbeit: Was steckt dahinter?
Care-Arbeit umfasst Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und Hausarbeit. Diese Aufgaben sind essenziell für das Funktionieren unserer Gesellschaft und oft ein Ausdruck von Fürsorge und Liebe. Dennoch bleibt Care-Arbeit meist unbezahlt und wird überwiegend von Frauen übernommen.
Der sogenannte „Gender-Care-Gap“ beschreibt den Unterschied in der Verteilung dieser Arbeit zwischen Frauen und Männern. Aktuelle Studien zeigen: Frauen investieren deutlich mehr Zeit wie Männer in unbezahlte Care-Arbeit – mit gravierenden Folgen für ihre Karriere, Gesundheit und finanzielle Sicherheit.
Warum ist das wichtig?
Die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit betrifft uns alle. Sie verstärkt bestehende Ungleichheiten und hindert uns daran, ein modernes und gleichberechtigtes Miteinander zu leben. Gerade in der Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen, wenn oft die Familiengründung ansteht, erreicht der Gender-Care-Gap seinen Höhepunkt: Frauen leisten hier bis zu 130 Prozent mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer.
Welche Folgen hat der Gender-Care-Gap?
Eine unausgewogene Verteilung der Sorgearbeit führt zu weitreichenden Konsequenzen:
- Karriere und Einkommen: Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was langfristig niedrigere Gehälter und begrenzte Karrierechancen bedeutet.
- Finanzielle Unsicherheit: Geringere Einkommen wirken sich direkt auf die Pensionsansprüche aus und erhöhen das Risiko von Altersarmut.
- Mehrfachbelastung: Frauen tragen oft die Last von Beruf, Haushalt und Familie – das führt zu Stress und gesundheitlichen Problemen.
- Fehlende Anerkennung: Obwohl Care-Arbeit essenziell ist, wird sie gesellschaftlich weniger wertgeschätzt als Erwerbsarbeit.
Warum lohnt sich eine partnerschaftliche Aufteilung?
Die gerechte Verteilung von Care-Arbeit ist der Schlüssel zu mehr Gleichberechtigung – in Beziehungen, in Familien und in der Gesellschaft. Männer, die sich stärker in die Care-Arbeit einbringen, berichten von engeren Beziehungen zu ihren Kindern und Partner:innen. Frauen gewinnen durch eine fairere Verteilung mehr Zeit für berufliche Entwicklung, Hobbys und eigene Bedürfnisse.
Eine „Fairteilung“ stärkt nicht nur die Beziehung, sondern schafft auch mehr Raum für gemeinsame Erlebnisse und ein erfüllteres Leben.
So gelingt die Fairteilung: Praktische Tipps
- Aufgaben sichtbar machen: Erst wenn alle Aufgaben aufgelistet sind, wird klar, wie viel Arbeit tatsächlich anfällt. Ein Haushaltsbuch oder Apps wie „4 Wände – 4 Hände“ helfen dabei.
- Regelmäßige Gespräche: Sprechen Sie regelmäßig über die Verteilung von Aufgaben. Bedürfnisse und Belastungen können sich ändern – Kommunikation bleibt daher entscheidend.
- Verbindliche Absprachen: Klare Verantwortlichkeiten schaffen Verlässlichkeit und beugen Konflikten vor.
- Flexibilität ermöglichen: Seien Sie bereit, Aufgaben je nach Lebenssituation neu zu verteilen. Care-Arbeit ist kein statisches Konzept, sondern muss sich an die Bedürfnisse der Familie anpassen.
- Schrittweise Veränderung: Für eine gerechte Aufteilung ist kein perfekter Start nötig. Kleine Schritte zählen und zeigen bereits große Wirkung.
Fazit: Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Care-Arbeit fair zu teilen, ist keine leichte Aufgabe, aber eine lohnende. Die Veränderung beginnt bei uns: im Gespräch mit Partner:innen, in der Familie und am Arbeitsplatz.
Eine gerechte Verteilung der Sorgearbeit stärkt nicht nur Frauen, sondern die gesamte Gesellschaft. Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen und Care-Arbeit sichtbarer zu machen – für ein Leben, in dem alle gewinnen.